Neuigkeiten
Hier finden Sie unsere aktuellen Neuigkeiten:
Forschungseinblicke
PATHWAY-Studie in den Medien
Wir freuen uns, dass unsere Forschung auch außerhalb der Wissenschaft Beachtung findet: Über unsere Studie wurde ein Artikel im „Standard“ veröffentlicht. Der Beitrag beleuchtet die aktuelle Diskussion rund um die Verlängerung der Volksschule und greift dabei zentrale Ergebnisse und Einschätzungen aus dem PATHWAY-Projekt auf.
Zum Artikel: „Sechs statt vier Jahre Volksschule – Was wurde aus Wiederkehrs Kompromiss?“ (derStandard, 12. Mai 2025)
Forschungseinblicke
Mehr Zeit, gleiche Chancen? Ergebnisse einer Lehrkräftestudie zur Verlängerung der Volksschulzeit
Mehr Zeit, gleiche Chancen? Ergebnisse einer Lehrkräftestudie zur Verlängerung der Volksschulzeit
Im Rahmen des vom Jubiläumsfonds der Oesterreichischen Nationalbank (OeNB) geförderten Forschungsprojekts PATHWAY („Akademische und sozial-emotionale Entwicklung von Kindern mit Lernbehinderung im Übergang von der Primarstufe in die Sekundarstufe I im inklusiven Unterricht“) wurden im Schuljahr 2024/25 52 qualitative Interviews mit Lehrkräften aus integrativen und nicht-integrativen Primar-, Sekundar- und Sonderschulen in Wien durchgeführt.
Das Projekt wurde geleitet von Univ.-Prof.in Dr.in Susanne Schwab und Dr.in Katharina-Theresa Lindner am Institut für Bildungswissenschaft der Universität Wien. Ziel der Studie war es, die Perspektiven und Erfahrungen von Lehrkräften zu Übergangsprozessen und zur diskutierten Verlängerung der Volksschulzeit von vier auf sechs Jahre systematisch zu erfassen.
Hintergrund der Diskussion
Der Vorschlag des Bildungsministers Christoph Wiederkehr (NEOS), in seiner ehemaligen Funktion als Wiener Bildungsstadtrat, die Volksschule auf sechs Jahre auszudehnen, zielt darauf ab, die vierte Klasse als „unglaubliche Belastung für alle Beteiligten“ zu entschärfen. Die Maßnahme soll den Übergang in die Sekundarstufe erleichtern und den Kindern mehr Zeit für ihre Entwicklung geben. Gleichzeitig betonte die Bildungssprecherin der NEOS, Martina Künsberg Sarre, dass die Verlängerung der gemeinsamen Beschulungszeit dazu beitragen könnte, „jedem Kind die Flügel zu heben, unabhängig vom sozialen Hintergrund.“
Ergebnisse
1. Übergänge als zentrale Belastungssituationen
Die Mehrheit der befragten Lehrkräfte beschreibt den Übergang von der Volksschule in die Sekundarstufe als eine Phase hoher Belastung – sowohl für Schüler:innen als auch für Eltern und Lehrpersonen. Leistungsdruck, emotionale Unsicherheit und soziale Vergleiche prägen diese Zeit.
Mangelnde Abstimmung zwischen den Schulstufen sowie unzureichende Konzepte für die Übergangsgestaltung wurden vielfach kritisiert. Gute Übergangsprozesse erfordern umfassende pädagogische Begleitung.
„Die vierte Klasse ist eine Zumutung für alle Beteiligten – wir bräuchten mehr Zeit, nicht mehr Druck.“ (Lehrkraft, Primarstufe)
2. Potenziale einer längeren Volksschulzeit
Die Verlängerung der Volksschulzeit wird von vielen Lehrpersonen grundsätzlich positiv beurteilt. Mehr Zeit könne dazu beitragen, Entwicklungsprozesse individueller zu gestalten, Entscheidungsdruck im Hinblick auf die Wahl der weiterführenden Schule zu entschärfen und Übergänge besser vorzubereiten.
Insbesondere aus der Perspektive der Inklusionspädagogik wird der Verbleib in einem vertrauten schulischen Umfeld für Kinder mit besonderen Bedürfnissen als bedeutender Vorteil angesehen.
„Die Reform könnte ein Hebel für mehr Bildungsgerechtigkeit sein – aber nur, wenn sie nicht isoliert bleibt.“ (Lehrkraft, Sekundarstufe 2)
3. Kritik: Ohne Ressourcen bleibt die Idee wirkungslos
Trotz positiver Einschätzung zeigen sich die Lehrpersonen skeptisch hinsichtlich der praktischen Umsetzung. Kritisiert werden Personalmangel, Infrastrukturdefizite und fehlende pädagogische Konzepte.
Zudem warnen einige Lehrkräfte, dass Übergangsprobleme nur zeitlich verschoben werden könnten, ohne strukturelle Ursachen zu beheben.
„Es fehlen die Räume, das Personal und die Konzepte, um eine solche Reform sinnvoll umzusetzen.“ (Lehrkraft, Inklusives Schulzentrum)
4. Bildungsgerechtigkeit erfordert mehr als Strukturreformen
Ein zentrales Ergebnis der Studie ist, dass strukturelle Veränderungen allein nicht ausreichen, um Bildungsungleichheiten zu reduzieren. Der soziale Hintergrund bleibt ein entscheidender Faktor für Bildungserfolg. Gefordert werden daher eine längere gemeinsame Schulzeit, eine Ressourcenumverteilung entlang sozialer Kriterien und der Ausbau von Fördermaßnahmen.
„Ohne soziale Durchmischung und strukturelle Maßnahmen bleibt die Ungleichheit bestehen.“ (Lehrkraft, Sekundarstufe 2)
Fazit
Die Interviews mit Wiener Lehrkräften zeigen klar: Die Verlängerung der Volksschulzeit birgt hohes Potenzial, Bildungslaufbahnen gerechter zu gestalten. Eine längere gemeinsame Schulzeit gibt Kindern mehr Zeit für persönliche und schulische Lernentwicklung und kann helfen, den Einfluss der sozialen Herkunft auf den Bildungserfolg abzumildern.
Internationale und nationale Forschung belegt seit Jahren, dass längere gemeinsame Lernzeiten ein wirksames Mittel sind, um Bildungsungerechtigkeit zu verringern. Eine Verlängerung der Volksschulzeit wäre daher ein Schritt in die richtige Richtung.
Doch Strukturänderungen allein reichen nicht. Wirkliche Fortschritte lassen sich nur erzielen, wenn Reformen durch zusätzliche Maßnahmen flankiert werden. Dazu gehören kleinere Klassen, multiprofessionelle Teams, eine konsequente individuelle Förderung und systematische Unterstützung in Übergangsphasen. Ohne diese Voraussetzungen besteht die Gefahr, dass die bestehenden Ungleichheiten nur zeitlich verschoben, nicht aber nachhaltig vermindert werden.
Aktuell stellt sich die Frage, ob der amtierende Bildungsminister die von ihm in seiner Funktion als Wiener Bildungsstadtrat vertretene Idee tatsächlich in eine bundesweite Reform überführen wird. Diesbezüglich fehlt derzeit eine verbindliche bildungspolitische Perspektive.
Die bildungspolitische Landschaft in Österreich gleicht momentan einem Flickenteppich aus Einzelmaßnahmen: Quereinsteiger:innen-Programme, punktuelle Förderinitiativen, vereinzelte Reformvorhaben. Was fehlt, ist ein systematischer Gesamtansatz. Bildungspolitik braucht keine Reparaturen an einzelnen Stellen, sondern ein tragfähiges Gesamtkonzept, das auf Prävention setzt. Echte Chancengerechtigkeit entsteht nur durch kohärente, langfristig gedachte Reformen.
Die Verlängerung der Volksschulzeit könnte – sinnvoll umgesetzt – Teil eines solchen Gesamtkonzepts sein. Sie muss jedoch eingebettet werden in eine Gesamtstrategie, die Qualität, Ressourcen und soziale Integration gemeinsam und von Anfang an mitdenkt.
Bildungsgerechtigkeit ist kein Nebenprodukt von Strukturreformen. Sie muss das Ergebnis bewusster politischer Entscheidungen sein, die sich an wissenschaftlicher Evidenz orientieren und langfristig am Ziel der Teilhabe für alle Kinder und Jugendlichen ausgerichtet ist.
Wissenschaftliche Kontakte:
Univ.-Prof.in Dr.in Susanne Schwab (Zentrum für Lehrer*innenbildung und Institut für Bildungswissenschaft, Universität Wien) – susanne.schwab@univie.ac.at
Dr.in Katharina-Theresa Lindner (Institut für Bildungswissenschaft, Universität Wien) – katharina-theresa.lindner@univie.ac.at
HS-Prof. Dr.in Marie Gitschthaler (KPH Wien/NÖ) – marie.gitschthaler@kphvie.ac.at
Alexandra Pirker, BSc BEd MEd (Zentrum für Lehrer*innenbildung, Universität Wien) – alexandra.pirker@univie.ac.at
Sonja Maria Schiebl, BEd MA MSc (Institut Professionalisierung im Bereich Elementar- und Primarbildung, PH Wien) – sonja.schiebl@phwien.ac.at
PATHWAY-Symposium: Multiperspektivische Einblicke und Perspektiven für eine inklusive Bildung
Veranstaltungen
Am 25. März 2025 fand ein Online-Symposium im Rahmen des Forschungsprojekts PATHWAY der Universität Wien statt. Die Veranstaltung bot eine Plattform für den Austausch zwischen Wissenschaft, Bildungspraxis und bildungspolitische Themen.
Ergebnisse und Impulse
Nach der Begrüßung durch Co-Projektleiterin und Moderatorin des Symposiums Dr.in Katharina-Theresa Lindner präsentierte Projektmitarbeiterin Alexandra Pirker, BSc BEd MEd die zentralen Ergebnisse des PATHWAY-Projekts. Dabei wurden nicht nur die Ergebnisse des Forschungsprojekts vorgestellt, sondern auch offene Fragen und zukünftige wissenschaftliche und praxisorientierte Impulse in Aussicht gestellt.
Ein besonderer Fokus lag auf der Verknüpfung der Forschungsergebnisse mit der Praxis. Im Zuge der Veranstaltung gab es Impulsvorträge, im Zuge welcher Expert:innen aus verschiedenen Bereichen ihre Perspektiven einbrachten. Dr. Rupert Corazza und Mag.a Julia Thalhammer, BEd von der Bildungsdirektion Wien, Fachbereich für Inklusion, Diversität und Sonderpädagogik gaben Einblicke in ihre bildungspolitische Arbeit mit Fokus auf Inklusion und beleuchteten die Bedeutung der Ergebnisse des Forschungsprojekts für die Bildungslandschaft und -politik. Mag. Hans-Peter Waldbauer, welcher im Bereich der Arbeitsassistenz von WUK Wien Bildung und Beratung tätig ist, präsentierte seinen Tätigkeitsbereich sowie praktische Erfahrungen mit der gemeinsam Zielgruppe (Schüler:innen mit Förderbedarf) an der Schnittstelle zwischen Schule und Beruf. Außerdem diskutierte er die Implikationen der PATHWAY-Projektergebnisse für den Bereich der Bildungsberatung. Prof.in Dr.in Verena Letzel-Alt von der Leuphana Universität Lüneburg bereicherte das Symposium durch inklusions- und bildungsbezogenen Forschungsergebnisse aus einer internationalen Perspektive und betonte die Bedeutung der Bedürfnisorientierung für mehr Chancengerechtigkeit im Bildungswesen, ebenso unter Bezugnahme der Ergebnisse des PATHWAY-Projekts.
Multiperspektivische Podiumsdiskussion
Den Abschluss des Symposiums bildete eine lebhafte Podiumsdiskussion, an der neben den Expert:innen Mag.a Julia Thalhammer, BEd, Mag. Hans-Peter Waldbauer und Prof.in Dr.in Verena Letzel-Alt auch die PATHWAY-Projektleitung Prof.in Dr.in Susanne Schwab teilnahm. Unter der Moderation von Dr.in Katharina-Theresa Lindner wurden die verschiedenen Perspektiven zusammengeführt und offene Fragen und Impulse diskutiert. Jene Diskussion verdeutlichte, dass die Umsetzung inklusiver Bildung ein komplexes Ziel zu sein scheint, das durch eine interdisziplinäre Zusammenarbeit zwischen Wissenschaft, Praxis und Politik erfolgreich erreicht werden soll.
Das PATHWAY-Symposium bot den Teilnehmer:innen Einblicke in die aktuelle Forschung und Praxis der inklusiven Bildung sowie in die Thematik, dass inklusive Bildung nicht nur eine Frage der Gerechtigkeit, sondern auch eine Chance für zukunftsfähige und bedürfnisorientierte Bildungserfolge darstellt.
Vergangene Neuigkeiten
Hier finden sie das Archiv aller bereits in der Vergangenheit liegenden Neuigkeiten:
Abschluss Erhebungen 2024
Quantitative Erhebungen
Mit dem Ende des Schuljahres wurde die Erhebungsphase des Jahres 2024 erfolgreich abgeschlossen, wodurch auch die Feldphase unseres Projekts in die Sommerferien übergeht.
Wir wünschen allen teilnehmenden Schüler:innen, Schulen und allen Interessierten an unserem PATHWAY-Projekt erholsame Sommerferien und eine schöne Urlaubszeit!
Abschluss Erhebungen 2023
Qualitative Erhebungen
Die Erhebungen für das Jahr 2023 wurden erfolgreich abgeschlossen.
Wir wünschen allen teilnehmenden Schüler:innen und Schulen, sowie allen Interessierten an unserem PATHWAY-Projekt schöne und erholsame Feiertage und einen guten Rutsch ins neue Jahr 2024!
Poster-Präsentation auf der EARLI Konferenz 2023
Im Zuge der EARLI 2023 stellten wir folgende Ergebnisse des PATHWAY-Projekts vor:
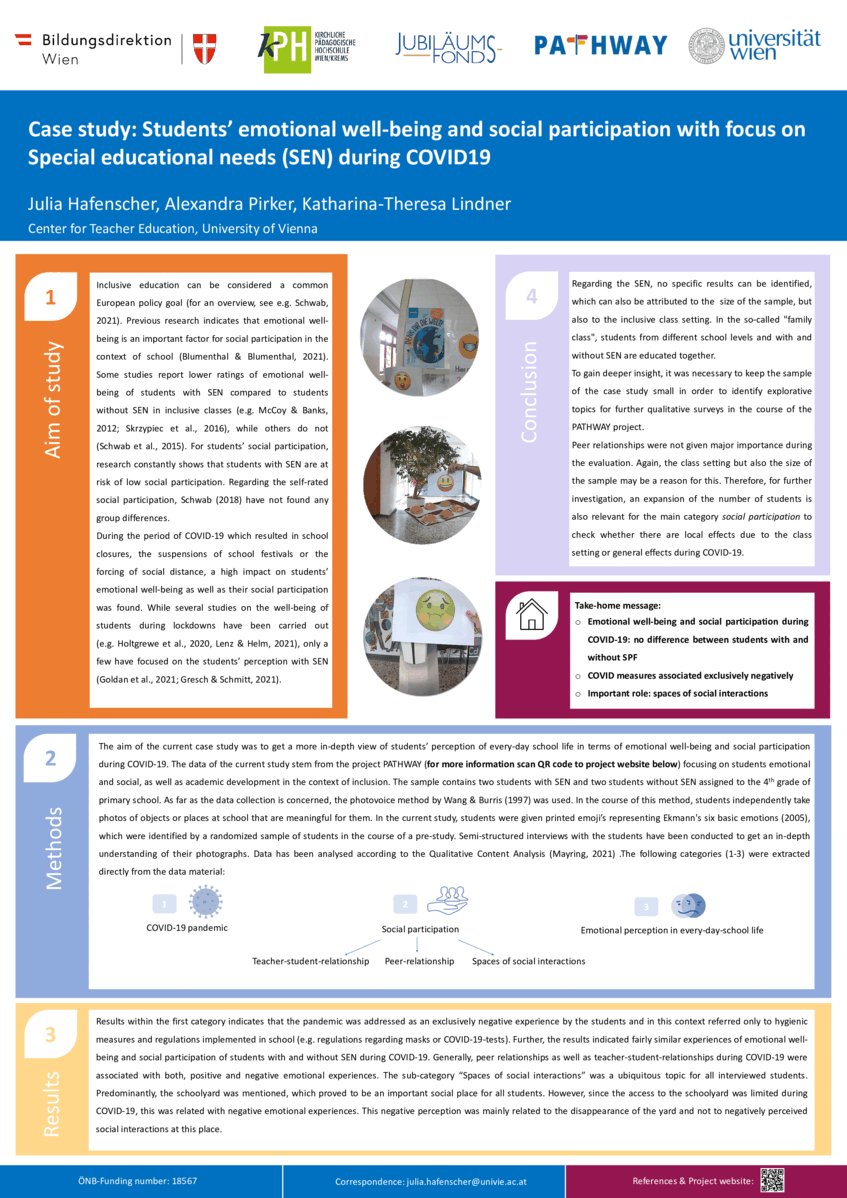
Referenzen:
Blumenthal, Y. & Blumenthal, S. (2021). Zur Situation von Grundschülerinnen und Grundschülern mit sonderpädagogischem Förderbedarf im Bereich emotionale und soziale Entwicklung im inklusiven Unterricht. Zeitschrift für pädagogische Psychologie, 1–16. doi.org./10.1024/1010-0652/a000323
Ekman, P. (2005). Basic Emotions. In Handbook of Cognition and Emotion; Dalgleish, T., Power, M.J., Eds.; John Wiley & Sons, Ltd.:Chichester.
Goldan, J., Kullmann, H., Zentarra, D., Geist, S. & Lütje-Klose, B. (2021). Schulisches Wohlbefinden von Schülerinnen und Schülern mit und ohne sonderpädagogischen Unterstützungsbedarf während der COVID-19-Pandemie – Erste Befunde aus dem Projekt WILS-Co an der Laborschule Bielefeld. Zeitschrift für Heilpädagogik, 72., 2021, 640-651.
Gresch, C. & Schmitt, M. (2021). Lernen und Wohlergehen von Schülerinnen und Schülern mit und ohne sonderpädagogische Förderbedarfe während der ersten Schulschließung 2020. Forschung kompakt, Bericht Nr. 3, 2021, 1-6.
Holtgrewe, U., Lindorfer, M., Siller, C. & Vana, I. (2020). Lernen im Ausnahmezustand – Chancen und Risiken. Wien: Zentrum für Soziale Innovation. www.zsi.at/de/object/publication/5698
Lenz, S. & Helm, C. (2021). Do students from open learning environments perceive advantages in distance learning during Corona-related school closures? Linz: Johannes Kepler Universität, Linz School of Education.
Mayring, P. (2021). Qualitative Content Analysis. A Step-by-Step Guide. London: SAGE Publications Ltd.
McCoy, S. & Banks, J. (2012). Simply academic? Why children with special educational needs don't like school. European Journal of Special Needs Education, 27(1), 81–97. doi.org/10.1080/08856257.2011.640487
Schwab, S. (2021). Inclusive and Special Education in Europe. In Sharma, U. & Salend, S. J. (Eds.), The Oxford encyclopedia of inclusive and special education. Oxford University Press.
Schwab, S. (2018). Peer-relations of students with special educational needs in inclusive education. In S. Polenghi, M. Fiorucci & L. Agostinetto (Hrsg.), Diritti Cittadinanza Inclusione (p. 15-24). Rovato: Pensa MultiMedia.
Schwab, S., Rossmann, P., Tanzer, N., Hagn, J., Oitzinger, S., Thurner, V., & Wimberger, T. (2015). Schulisches Wohlbefinden von SchülerInnen mit und ohne sonderpädagogischen Förderbedarf. Zeitschrift für Kinder- und Jugendpsychiatrie und Psychotherapie, 43(4), 265–274. doi.org/10.1024/1422-4917/a000363
Skrzypiec, G., Askell-Williams, H., Slee, P., and Rudzinski, A. (2016). Students with self-identified special educational needs and disabilities (si-SEND): flourishing or languishing! Int. J. Disabil. Dev. Educ., 63, 7–26. doi.org/10.1080/1034912X.2015.1111301
Wang, C., & Burris, M. A. (1997). Photovoice: Concept, methodology, and use for participatory needs assessment. Health education & behavior. The official publication of the Society for Public Health Education, 24(3), 369–387. doi.org/10.1177/109019819702400309
Abschluss Erhebungen 2024
Qualitative Erhebungen
Die Erhebungen für das Jahr 2024 wurden erfolgreich abgeschlossen.
Wir wünschen allen teilnehmenden Schüler:innen und Schulen, sowie allen Interessierten an unserem PATHWAY-Projekt schöne und erholsame Feiertage und einen guten Rutsch ins Jahr 2024!
Erhebungen Frühjahr & Sommer 2023
Quantitative Erhebungen
Auch in diesem Sommersemester dürfen wir wieder unsere teilnehmenden Schulen mit unseren quantitativen Erhebungen besuchen und freuen uns sehr wieder neue Einblicke in das Schulleben unserer partizipierenden Schüler:innen und Schulen zu bekommen, bevor es in die Sommerferien geht!
VERLÄNGERUNG - AUSSCHREIBUNG Masterarbeiten Sommersemester 2023
Mitarbeit im Forschungsprojekt PATHWAY
Die Bewerbungsfrist für ein Mitwirken im Zuge einer Masterarbeit wurde bis 19.03.2023 verlängert!
Sollten Sie daran interessiert sein, die Projekt-Erhebungen unterstützend zu begleiten und im Rahmen dessen Ihre Masterarbeit zu verfassen, bitten wir Sie um die Zusendung eines kurzen Lebenslaufs an die Projekt-Mail-Adresse:
pathway.bildungswissenschaft@univie.ac.at
Der Termin für das erste Kennenlernen via Zoom wird an alle Bewerber:innen gesendet, sobald die Frist vorbei ist.
AUSSCHREIBUNG Masterarbeiten Sommersemester 2023
Mitarbeit im Forschungsprojekt PATHWAY
Im Rahmen des Forschungsprojekts PATHWAY zum Thema „sozio-emotionale und akademische Entwicklung von Schüler*innen an Wiener Schulen“ am Institut für Bildungswissenschaft werden Studierende zur Unterstützung der quantitativen oder qualitativen Datenerhebung von März bis Juni 2023 gesucht. Im thematischen Fokus der Datenerhebung stehen sozio-emotionale und Lernstands-Entwicklung von Schüler*innen verschiedener Wiener Schulen der 5. Und 6. Schulstufe sowie Perspektiven jener Schüler*innen und deren Lehrpersonen bezüglich Unterrichtsprozessen. Die Erhebungen finden mittels quantitativer Fragebögen (paper-pencil) und qualitativer Interviews statt. Studierende werden im Rahmen ihrer Teilnahme am Projekt folgende Forschungstätigkeiten durchführen, je nach Bewerbung für den quantitativen oder qualitativen Teil:
Quantitativ:
- Organisation der Erhebungen (Vorbereitung der Fragebögen, etc.)
- Durchführung von Erhebungen an Schulen (mindestens paarweise)
- Nachbereitung der Erhebungen (Anonymisierung der Fragebögen, eventuell Dateneingabe etc.)
- Entwicklung von Forschungsinteresse und Forschungsfragen
- Analyse der Daten mit Fokus auf eigene Forschungsfrage
Qualitativ:
- Nachbereitung der Erhebungen (hauptsächlich Transkription)
- Entwicklung von Forschungsinteresse und Forschungsfrage
- Analyse der Daten mit Fokus auf eigene Forschungsfrage
Voraussetzungen:
- Student*innen des Masterstudiengangs Bildungswissenschaftbzw. der Inklusiven Pädagogik
- Interesse am Forschungsbereich
- Kenntnisse quantitativer oder qualitativer Forschung
- Selbstständige Organisationstätigkeit und Zuverlässigkeit – der quantitative Erhebungszeitraum ist März bis Juni 2023, die Erhebungen finden ausschließlich vormittags (während der regulären Schulunterrichtszeit) statt. Bei Mitarbeit im Zuge der qualitativen Forschung ist keine Verfügbarkeit am vormittags Voraussetzung.
Die Masterarbeiten werden nach Absprache von Projektleitung Prof.in Dr.in Susanne Schwab und/oder Dr.in Katharina-Theresa Lindner betreut.
Sollten Sie daran interessiert sein, die Projekt-Erhebungen unterstützend zu begleiten und im Rahmen dessen Ihre Masterarbeit zu verfassen, bitten wir Sie um die Zusendung eines kurzen Lebenslaufs bis 28.02.2023 an die Projekt-Mail-Adresse:
pathway.bildungswissenschaft@univie.ac.at
Zur Klärung etwaiger Fragen und Unklarheiten wird ein erstes Kennenlernen sowie eine Einschulung in die Arbeitsprozesse im Projekt stattfinden, wobei der Termin noch bekannt gegeben wird (online via Zoom).
Erhebungen Winter 2023
Qualitative Erhebungen
Seit Jänner haben wir mit unseren qualitativen Interviews mit ausgewählten Schüler*innen begonnen, die bereits an der quantitativen Erhebungen teilgenommen haben.
Im Zuge der Erhebungen führen wir zum einem Interviews auf Basis der Photovoice-Methode durch, bei denen Schüler*innen mittels von uns zur Verfügung gestellten Kameras verschiedene Fotos von Orten in der Schule anfertigen. Mit diesesn Fotos werden die Interviews sodann durchgeführt.
Zusätzlich werden Interview mit einzelnen Schüler*innen, deren Lehrpersonen und einem Erziehungsberechtigten durchgeführt, um hier einen vielschichtigen Einblick in die Lebenswelt zu bekommen.
Erhebungen Herbst 2022
Quantitative Erhebungen
Im Juni des vergangen Schuljahres haben wir unterschiedliche Schulen der Primarstufe in Wien besucht und durften viele neue Schüler*innen, Schul-Teams und Schulen kennenlernen.
Mit diesem Schuljahr starten wir in eine neue Erhebung und besuchen Schüler*innen in der Sekundarstufe in verschiedenen Wiener Schulen das erste Mal. Der Start der neuen Erhebungsrunde ist Oktober 2022.
Wir freuen uns schon sehr darauf, auch hier wieder neue Einblicke in die schulische Lebenswelt neuer Schüler*innen in Wien zu erhalten!
